Können Software-Tools helfen, sich beim digitalen Lernen nicht ablenken zu lassen?
Bericht: DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
 Wer digital lernt, ist schnell abgelenkt. Denn die verwendeten Geräte bieten viele Möglichkeiten, sich die Zeit anderweitig zu vertreiben. Inzwischen existiert eine große Anzahl von Software-Anwendungen, die helfen sollen, bei der Sache zu bleiben. Aber wie werden diese Tools zur Selbstkontrolle genutzt und als wie nützlich werden sie empfunden? Das hat eine neue Studie des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation mit 273 Studierenden untersucht. Ergebnis: Die Tools bieten keine Universallösung. Die Nutzer*innen brauchen individuelle Einstellungen und müssen gut über die Möglichkeiten der Programme informiert sein. … weiter
Wer digital lernt, ist schnell abgelenkt. Denn die verwendeten Geräte bieten viele Möglichkeiten, sich die Zeit anderweitig zu vertreiben. Inzwischen existiert eine große Anzahl von Software-Anwendungen, die helfen sollen, bei der Sache zu bleiben. Aber wie werden diese Tools zur Selbstkontrolle genutzt und als wie nützlich werden sie empfunden? Das hat eine neue Studie des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation mit 273 Studierenden untersucht. Ergebnis: Die Tools bieten keine Universallösung. Die Nutzer*innen brauchen individuelle Einstellungen und müssen gut über die Möglichkeiten der Programme informiert sein. … weiter
Quelle:
www.idw-online.de
www.dipf.de
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

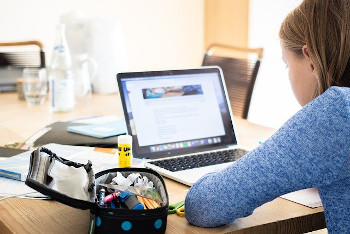 Ob Schülerinnen und Schüler vom Einsatz von Technologie im Unterricht profitieren, hängt weniger davon ab, wie intensiv digitale Medien eingesetzt werden als vielmehr davon, wie sie genutzt werden. Wenn ihr Einsatz zum Nachdenken anregt oder beispielsweise dazu, Ergebnisse zu diskutieren, haben sie durchaus das Potenzial, die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen. Das konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in einer Studie zeigen. Sie untersuchten, ob der Einsatz digitaler Medien die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen kann und ob Veränderungen im Lernverhalten sowohl mit der Häufigkeit als auch mit der Qualität des Einsatzes in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Contemporary Educational Psychology veröffentlicht. …
Ob Schülerinnen und Schüler vom Einsatz von Technologie im Unterricht profitieren, hängt weniger davon ab, wie intensiv digitale Medien eingesetzt werden als vielmehr davon, wie sie genutzt werden. Wenn ihr Einsatz zum Nachdenken anregt oder beispielsweise dazu, Ergebnisse zu diskutieren, haben sie durchaus das Potenzial, die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen. Das konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in einer Studie zeigen. Sie untersuchten, ob der Einsatz digitaler Medien die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflussen kann und ob Veränderungen im Lernverhalten sowohl mit der Häufigkeit als auch mit der Qualität des Einsatzes in Zusammenhang stehen. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Contemporary Educational Psychology veröffentlicht. …  Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt, dass die Ergänzung der Digitalisierungsstrategie der Kultusministerkonferenz (KMK) in die richtige Richtung gehe. Gleichzeitig benannte die Bildungsgewerkschaft aber auch Bau- und Leerstellen des Papiers. „Die neue Schwerpunktsetzung ist völlig richtig. Der Fokus wird nicht mehr nur auf die Anwendungsorientierung gelegt, sondern es geht darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, souverän und mündig an der digitalen Welt teilzuhaben und diese mitzugestalten“, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule, mit Blick auf das Ergänzungspapier „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“, das die KMK am Freitag veröffentlicht hat.
Frankfurt a.M. – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt, dass die Ergänzung der Digitalisierungsstrategie der Kultusministerkonferenz (KMK) in die richtige Richtung gehe. Gleichzeitig benannte die Bildungsgewerkschaft aber auch Bau- und Leerstellen des Papiers. „Die neue Schwerpunktsetzung ist völlig richtig. Der Fokus wird nicht mehr nur auf die Anwendungsorientierung gelegt, sondern es geht darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, souverän und mündig an der digitalen Welt teilzuhaben und diese mitzugestalten“, sagte Anja Bensinger-Stolze, GEW-Vorstandsmitglied Schule, mit Blick auf das Ergänzungspapier „Lehren und Lernen in der digitalen Welt“, das die KMK am Freitag veröffentlicht hat.  Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitieren im Mathematikunterricht stärker von Lernmaterialien auf Tablets als leistungsstärkere Kinder. Ihnen helfen offenbar ein individueller Schwierigkeitsgrad, unmittelbares Feedback und die Bearbeitung interaktiver Aufgaben mit den Händen.
Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitieren im Mathematikunterricht stärker von Lernmaterialien auf Tablets als leistungsstärkere Kinder. Ihnen helfen offenbar ein individueller Schwierigkeitsgrad, unmittelbares Feedback und die Bearbeitung interaktiver Aufgaben mit den Händen.